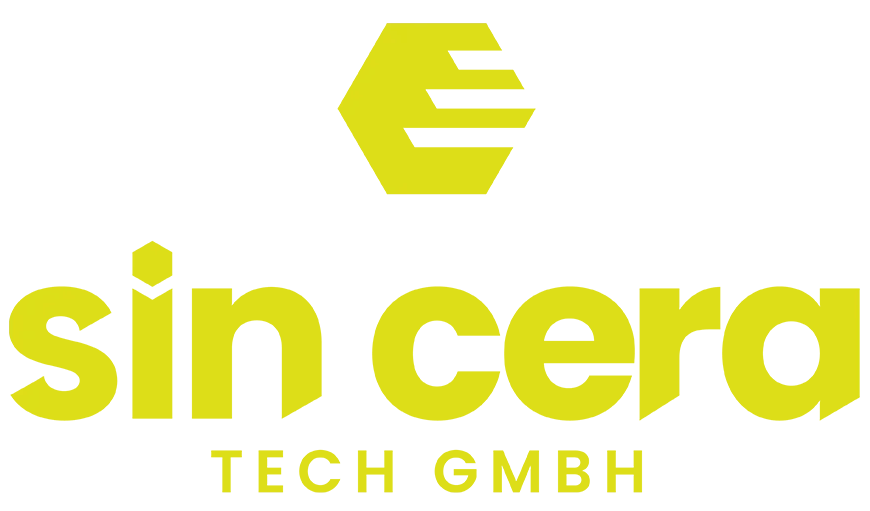Smart Care. Real Impact.
Die Digitalisierung im Gesundheitswesen ist kein optionaler Trend, sondern eine notwendige Entwicklung, um die Qualität der Versorgung, die Effizienz der Abläufe und die Zufriedenheit von Patienten und Fachpersonal zu sichern.
Entscheidend ist dabei eine abgestimmte Kombination aus technischer Infrastruktur, qualifizierten Mitarbeitenden und datenschutzkonformen Prozessen.
Mit Erfahrungen aus dem internationalen Gesundheitswesen der letzten Jahrzehnte stehen wir Ihnen beratend zur Seite, wenn Sie neue Systeme auswählen möchten, und unterstützen Sie bei der Umsetzung.
Im Bereich der Cybersecurity stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Unsere Mitarbeiter sind immer auf dem neuesten Stand und lassen Sie in keiner Situation im Stich. In dieser schnellen Welt gibt es nicht die eine allumfassende Lösung. Wir sind Experten in Schnittstellen und schließen darüber die Lücken die die System mit sich bringen.
Wenn Sie aktive Unterstützung suchen, so haben wir auch Teams, die KI-Agenten entwicklen, Ihre hauseigene Software erweitern oder andere IT Probleme lösen.
Digitalisierung der Verwaltung
Verwaltungsprozesse in Krankenhäusern, Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen sind traditionell papierintensiv und zeitaufwändig. Durch die Einführung digitaler Verwaltungsstrukturen – etwa elektronischer Terminplanung, automatisierter Abrechnungssysteme und digitaler Personalverwaltung – können Arbeitsabläufe deutlich beschleunigt und Fehlerquellen reduziert werden. Gleichzeitig verbessert die Digitalisierung die Transparenz von Prozessen, erleichtert das Controlling und ermöglicht die Analyse betrieblicher Kennzahlen in Echtzeit.
Die elektronische Patientenakte (ePA) ist das Herzstück einer modernen, digitalen Gesundheitsinfrastruktur. Sie ermöglicht eine strukturierte, sichere und ortsunabhängige Speicherung aller medizinisch relevanten Daten eines Patienten – von der Anamnese über Laborwerte bis hin zu Bilddaten. Ärzte, Pflegekräfte und Therapeuten können so schneller auf Informationen zugreifen, Doppeluntersuchungen vermeiden und Behandlungen gezielter planen.
Digitale Patientendokumentation
Digitalisierung der Befundung
In der Radiologie, Pathologie oder Labormedizin ermöglicht die Digitalisierung eine automatisierte und standardisierte Befundung. Moderne Systeme mit künstlicher Intelligenz (KI) unterstützen Ärzte bei der Analyse von Bildern oder Messdaten, erkennen Muster und Anomalien schneller und präziser als je zuvor. Dadurch wird nicht nur die Befundqualität gesteigert, sondern auch die Arbeitsbelastung medizinischer Fachkräfte reduziert. Digitale Befundplattformen erleichtern außerdem die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Fachabteilungen und Einrichtungen.